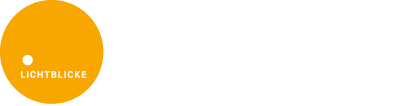Spitzenmedizin mit Empathie und Herz
Bereits seit 2010 ist Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald Direktor und Chefarzt der damals ersten Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Augsburger Klinikum. Als Spezialist für Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen war er maßgeblich am Aufbau des „Schwäbischen Kinderkrebszentrums“ und der Entwicklung eines Forschungskonzeptes für die Errichtung einer Universitätsmedizin in Augsburg beteiligt. Als breit vernetzter internationaler Experte ist Frühwald nicht nur erfahrener Kinderonkologe, sondern auch ein exzellenter Wissenschaftler, der die zukünftige Forschung und Lehre in Augsburg entscheidend mitgestaltet. Auch die Elterninitiative krebskranker Kinder ist dankbar, in vertrauensvollem Austausch Teil dieser Visionen zu sein. Wir bedanken uns sehr für die Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere erfolgreiche, gemeinsame Jahre.
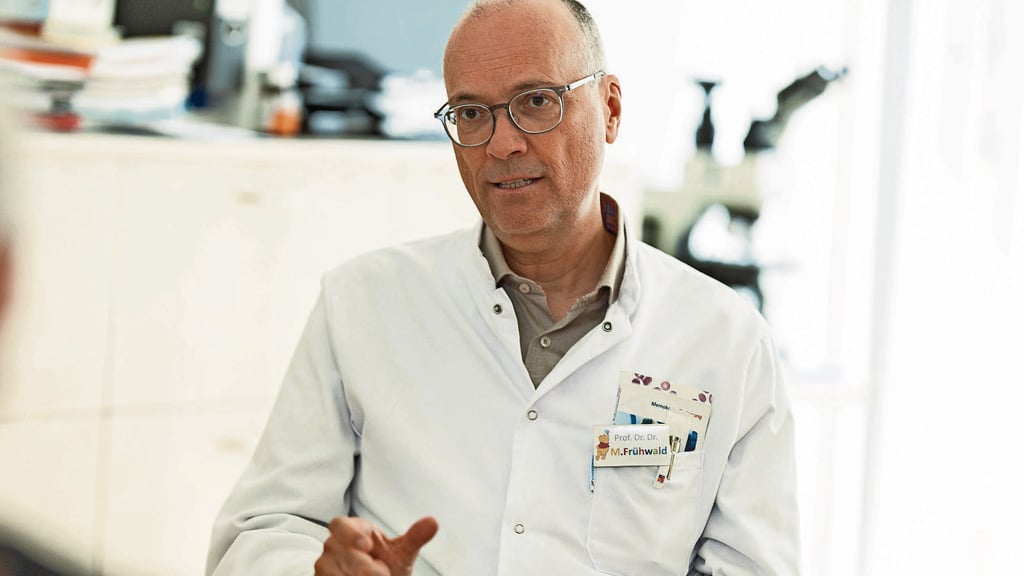
Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald leitet die Augsburger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bereits seit 2010.
Interview mit Iris Steiner
Warum ist es so besonders, das Schwäbische Kinderkrebszentrum hier an der Uniklinik Augsburg zu haben? Was unterscheidet dieses Zentrum von der „normalen“ Kinderonkologie einer Uniklinik?
Unsere Kinderonkologie ist eine komplett eigenständige eigene Einheit. Das macht sich schon dadurch bemerkbar, dass es ein separates Gebäude ist – und dass wir hier ein angegliedertes Kinderkrebsforschungszentrum haben. Und wir haben u.a. SIE – einen großzügigen Verein, mit dem wir in dauerhaftem überaus wohlwollendem Austausch stehen.
Was können Unterstützer wie wir tun, was der Krankenhausträger nicht tut? Wo können wir Ihnen helfen?
Das ist eine hervorragende Frage. Es gab vor ungefähr zehn Jahren eine große Umfrage, welche eigentlich notwendigen Unterstützungsmaßnahmen über private Spenden finanziert werden. Und dabei kam heraus, dass es da ein riesiges, wichtiges Thema gibt: die psychosoziale Unterstützung der Familien erkrankter Kinder. Man kann sagen, dass alles, was auf die normale medizinische Behandlung „oben drauf“ kommt, nur durch Unterstützervereine möglich gemacht wird. Ohne sie wäre unsere Station sehr arm und sehr trostlos. Wenn Sie dagegen jetzt zu uns kommen, haben Sie in manchen Bereichen den Eindruck, als ob man zu Hause oder in einer schönen Jugendeinrichtung ist, wo es einen Platz gibt zum Spielen, um Sport zu machen, wo es Mitarbeitende des psychosozialen Dienstes gibt, die sich mit den Jugendlichen zurückziehen können, wo Eltern miteinander Kaffee trinken können, wo es eine Terrasse gibt, auf der die Eltern abends zusammensitzen, tief durchatmen oder auch mal miteinander heulen können. Das ist manchmal notwendig, weil alle eine sehr harte Zeit durchmachen.
Wie viele kleine Patientinnen und Patienten kann man am Schwäbischen Kinderkrebszentrum eigentlich gleichzeitig behandeln?
Wir haben 22 stationäre Plätze, eine große Tagesklinik, in der wir zusätzlich sechs Kinder und Jugendliche täglich sehen können, und ein großes Ambulanzzentrum. Vor allem im letzten Jahr sind wir damit zu einer der größten kinderonkologischen Einheiten in Deutschland aufgestiegen. Und das, obwohl es das „Schwäbische Kinderkrebszentrum“ erst seit den 1980er Jahren gibt – auf der Basis der Kinderklinik, die 1967 eröffnet wurde. In der jetzigen Form gibt es uns eigentlich erst seit 2014, als die neue Kinderklinik gebaut wurde, das „Schwäbische Kinderkrebszentrum“ eine eigene Struktur bekommen hat und das Kinderkrebsforschungszentrum dazu kam.
Das „Schwäbische Kinderkrebszentrum“ ist also eine eigene Einheit der medizinischen, psychologischen und sonstigen Betreuung von Familien mit ihren Kindern? Und das im Unterschied zur Erwachsenen-Therapie?
Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ein Kind braucht seine Familie, es hat ganz andere Bedürfnisse als ein erwachsener, einwilligungsfähiger Patient, der selbst entscheiden kann, welche Behandlung er möchte und welche nicht. Auch die psychologische Betreuung sieht ganz anders aus – wenn das Kind etwa einen Vater hat, der seinen Job verliert, weil er mit dem Kind in der Klinik ist, oder eine Mutter, die auch noch Geschwisterkinder betreuen muss. Da entstehen Notfallsituationen, wo wir mit dem entsprechenden Team signifikant helfen können: Jemand kommt nach Hause, medizinische Betreuung durch Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte kann vor Ort geschehen. Dann gibt es noch unser psychosoziales Team aus Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Spiel- und Musiktherapeutinnen und ‑therapeuten. Und wir können auch sozialrechtliche Beratung anbieten – und zum Beispiel mit dem Arbeitgeber des von Kündigung bedrohten Vaters reden. Oder Mitarbeitende aus der Psychologie und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in die Schule der Geschwisterkinder schicken, die das Umfeld über die schwierige Situation der betroffenen Familie geschult unterrichten.
Wie ist die Prognose für onkologische Neuerkrankungen bei Kindern heute? Was hat sich in der Behandlung getan?
Vieles. Wir haben viele Patienten, die heute nicht mehr an der Erkrankung versterben, weil es unter anderem neue, stabilisierende Medikamente gibt. Dazu gibt es sogenannte zelluläre Immuntherapien, die das Immunsystem befähigen, sich gegen den Krebs zu wehren. Es gibt Antikörpertherapien und moderne Strahlentherapie-Techniken, die weniger Nebenwirkungen haben.
Wie lange arbeiten Sie schon mit der Elterninitiative krebskranker Kinder zusammen?
Ich durfte bereits als leitender Oberarzt in Münster erfahren, wie wichtig lokale Elternvereine sind. Deswegen habe ich mich schon bevor ich nach Augsburg kam informiert, was es da für ein Umfeld gibt, und war sehr glücklich, als damals meine Oberärztin auf der kinderonkologischen Station mich in diese Kreise eingeführt hat. Ich hatte innerhalb weniger Wochen nach meinem Arbeitsantritt hier in Augsburg am 1. Juni 2010 bereits die ersten Kontakte.
Welche Bedeutung hat die Arbeit der Elterninitiative jetzt für ihre Arbeit im Speziellen?
Da gibt es viele Ansatzpunkte. Ein wichtiger, den ich vorab betonen möchte, ist die unkomplizierte Zusammenarbeit. In der Regel genügt in einer Notlagensituation eine kurze Kontaktaufnahme, eine E‑Mail oder ein Anruf beim Geschäftsführer Herrn Kleist oder direkt bei Herrn Koller, damit man sich unmittelbar mit diesem Problem beschäftigt. Das ist eine Qualität, die es nicht überall gibt. Das andere, was uns unmittelbar wirklich hilft, ist die direkte Unterstützung der Familien. Wenn zu Hause ein Kind Krebs hat und man ein Wohnzimmer renovieren oder ein Schlafzimmer umbauen muss, damit dort die hygienischen Umstände passen, dann gibt es unmittelbare Hilfe, die unschätzbar ist. Und dann finanziert in unserem Fall die Elterninitiative auch einige Mitarbeiter des psychosozialen Teams: die Spieltherapeutin, Teile der Psychologenstellen und die Klinik-Clowns.
Wäre nicht die psychologische Betreuung eine medizinische Maßnahme, die man auch dem Träger zumuten könnte? Mittlerweile ist ja bekannt, dass psychische Gesundheit nicht unerheblich zur Genesung beiträgt, gerade bei Kindern. Was meinen Sie dazu?
Das ist richtig und selbstverständlich gibt es dazu kontinuierlich Gespräche mit den Kostenträgern. Wir betonen, dass die Elterninitiative seit Jahren Stellen für Psychologie bezahlt, die eigentlich Trägeraufgabe wäre. Wir betonen ununterbrochen, dass Kindermedizin sich von der Erwachsenenmedizin entscheidend unterscheidet und einen höheren Investitionsbedarf hat. Leider ist dafür in unserem Gesundheitssystem zu wenig Geld, das muss man offen und ehrlich sagen. Es gibt auch einen sogenannten GBA-Beschluss zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Krebs generell (GBA: ein beratendes Gremium für die Regierung, das Kriterien festlegt). Da steht ganz klar drin, dass wir nur dann abrechnen dürfen, wenn bestimmte Qualitätsmerkmale vorgehalten werden. Dazu gehört die psychosoziale Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Und genau hier ist das Problem einer Diskrepanz zwischen realen Kosten und theoretischer Finanzierung.
Wie lautet denn die Antwort, wenn Sie auf solche Missstände hinweisen?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass es eine große Akzeptanz für unsere Sichtweise gibt. Aber leider werden medizinische Leistungen im Krankenhaus insgesamt zu gering vergütet. Wir haben ein insgesamt defizitäres und mittlerweile leider auch ein merkantiles System. Gerade die sogenannte „sprechende Medizin“ – wie Psychologie oder Kinder- und Jugendmedizin – ist fast schmerzhaft unterfinanziert. Man vergisst dabei komplett, dass ja auch jedes Mal das „System Familie“ erkrankt, nicht nur das einzelne Kind!

„Es ist für uns unerlässlich, in permanentem Austausch mit Menschen zu sein, die eine solche Krankheit durchlebt haben.“ Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald im Gespräch mit Iris Steiner
Welche Beispiele, welche gemeinsame Projekte mit der Elternitiative fallen Ihnen spontan ein?
Da gibt es eine ganze Reihe von Projekten, unser „Marktplatz“ auf der Station etwa – übrigens etwas, das nur wenige Stationen in Deutschland haben. Es ist ein Begegnungsraum für Familien, ein Raum für Therapien und für Schule. Da sehe ich oft Lehrer mit den Kindern sitzen und Unterricht abhalten. Ich sehe aber auch die Sporttherapeutin, wie sie mit dem Jungen, der unbedingt mal raus möchte, Fußball spielt, wo sie Geschicklichkeitsspiele macht mit dem Mädchen, das gerade gegen eine Hirntumorerkrankung kämpft. Und dann gibt es noch ganz konkrete Dinge wie Unterstützung bei medizinischem Bedarf. Wir werden von der Elterninitiative sehr unterstützt, wenn wir sagen und begründen, dass wir dringend ein bestimmtes Gerät brauchen, das jetzt gerade im Investitionsbudget des Hauses nicht drin ist.
Was auch bereits die Brücke zur Forschung bildet: Wir haben den Auftrag, das Leben der Kinder und Jugendlichen besser zu machen, nicht nur indem wir die medizinische Versorgung so gut wie möglich gestalten, sondern auch, indem wir neue Erkenntnisse gewinnen, um die Erkrankungen so gut wie möglich zu verstehen. Wenn wir neue Ansatzpunkte finden, können wir eine Krebserkrankung wieder ein Stück besser attackieren.
Wir haben im Verein auch einige Eltern ehemaliger krebserkrankter Kinder. Gibt es eine besondere Verbindung zu Ihnen oder ist eine besondere Art von Kommunikation möglich, wenn man mit solchen Betroffenen sprechen kann?
Es ist sehr wichtig, dass sich Menschen engagieren, die das durchlebt haben. Die wissen, wie es ist, Angst um das Leben des Kindes zu haben, wie es ist, Angst vor der Zukunft zu haben und was den Kindern auf Station Mut machen kann. Die Beteiligung der Eltern ist ja nicht nur in den Elternvereinen mittlerweile fest etabliert, sondern auch wir in der Klinik integrieren Eltern und überlebende Patientinnen und Patienten in die Forschung. Es gibt in unserem „Bayerischen Zentrum für Krebsforschung“ und im „Kinderonkologischen Netzwerk Bayern“ Vertreter aus Elternvereinen und Überlebende, die uns korrigieren, wenn wir uns um die „falschen“ Sachen kümmern. Was einem Forscher wichtig ist, muss nicht unbedingt die höchste Bedeutung für Familien und Überlebende haben. Dieser Spiegel, den man uns hier vorhält, ist unheimlich wichtig.
Vereine wie der unsere organisieren in regelmäßigen Abständen öffentliche Stammzellenspenden-Aktionen. Etwas, das nicht so einfach zu erklären ist, wie etwa eine Blutspende. Können Sie helfen?
Die sogenannte „zelluläre Immuntherapie“ besteht darin, dass man von einem Fremdspender Blutstammzellen entnimmt und diese beispielsweise nach einer hochdosierten Chemotherapie dem Patienten injiziert. Diese Blutstammzellen – das fremde Knochenmark, das fremde Immunsystem – verleihen der Therapie eine zusätzliche Qualität. Wir müssen ja zunächst dem Körper leider Gifte verabreichen, um das weitere Schnellteilen der Krebszellen zu verhindern. Im Gegenzug braucht man – einfach formuliert – „Unterstützung“: ein Immunsystem, das immer dann, wenn wieder eine böse Zelle entsteht, dabei hilft, diese wegzuschaffen. Das kann nur fremdes Knochenmark tun und deshalb ist die Blutstammzelle so wichtig. Übrigens kann jeder gesunde Mensch bis etwa Mitte 50 Stammzellen spenden.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Zusammenarbeit, welche Schwerpunkte sehen Sie für die nächsten Jahre in der gemeinsamen Arbeit?
Zuerst bin ich einfach extrem glücklich, wie gut die Zusammenarbeit gelingt – eine komplett reibungsfreie, sehr angenehme, freundliche, wertschätzende und zum Teil auch korrigierende Zusammenarbeit. Manchmal wendet man sich einfach in seiner Not an die Elterninitiative – und dann ist es gut, wenn einen jemand darauf hinweist, dass es für das eine oder andere Problem auch eine andere Lösung geben müsste.
Mit dem Wandel von einer kommunalen Klinik zu einer Universitätsklinik haben sich Ihre Aufgaben sicher geändert …?
Wir haben heute Aufgaben in drei Gebieten: Lehre, Forschung und Krankenversorgung. Für die Lehre kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft Studierenden beibringen, wie eine Chemotherapie oder bestimmte kleine Eingriffe funktionieren. Dafür brauchen wir die Elterninitiative nicht zwingend. Eher vielleicht dann, wenn es darum geht, ein Modell für eine Knochenmark-Punktion zu finanzieren, das im Budget nicht enthalten ist.
Für unsere Forschungsarbeit konnten wir in den letzten Jahren zunehmend Fachpersonal zu uns holen. Frau Prof. Kuhlen, eine führende Forscherin, die sich hauptsächlich mit Tumoren der Drüsen beschäftigt. Oder auch Prof. Johann, der bei uns molekularbiologisch forscht, um die genaue Zusammensetzung eines Tumors sehen zu können und wie er mit dem Immunsystem zusammenspielt. Dadurch verstehen wir besser die Wachstumsmechanismen von Tumoren und hoffentlich auch, wie wir sie besser behandeln können. Ich wünsche mir für die Zukunft sehr, dass wir zusammen mit der Elterninitiative noch viele Forschungsprojekte durchführen können – solche, die die Augsburger Kinderkrebsforschung maßgeblich voranbringen.